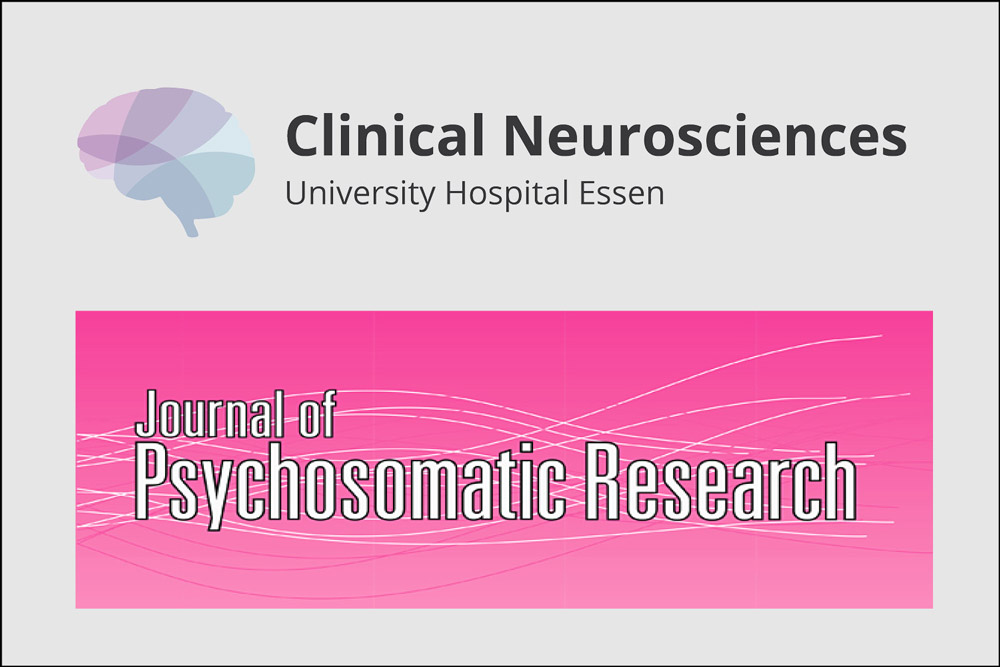
Es ist eine der erstaunlichsten Entdeckungen der jüngeren Placeboforschung: Placebos können auch dann eine Wirkung entfalten, wenn Patientinnen und Patienten wissen, dass sie gerade eine Pille ohne Wirkstoff erhalten. Viele Menschen zeigen sich sogar offen dafür, solche so genannten Open-Label-Placebos (OLPs) bewusst als Therapie einzunehmen.
Mehrere Mitglieder des SFB/TRR 289 forschen daran, ob und wie OLPs etablierte Therapien ergänzen könnten – vor allem dann, wenn herkömmliche Behandlungen nicht die erwünschte Wirkung entfalten. Ein Team um Katarina Forkmann vom Universitätklinikum Essen hat nun Patienten und Patientinnen gefragt, wie eine solche OLP-Therapie aussehen müsste, um möglichst wirksam zu sein. Die kürzlich im Journal of Psychosomatic Research veröffentlichten Antworten waren erstaunlich differenziert:
- Allgemein fanden die Befragten runde, weiße Pillen am attraktivsten, überzeugendsten und sprachen ihnen die größte Wirkung zu. Für manche Symptome wurden jedoch andere Formen bevorzugt.
- Am liebsten würden die Befragten das Placebo einmal täglich einnehmen. Allerdings erwarteten sie die größte Wirkung von einer zweimal täglichen Einnahme.
- Bezahlen würden die Teilnehmenden am meisten für eine Placebo-Therapie gegen chronische Schmerzen, Schlafstörungen oder zur Stimmungsverbesserung.
Die Darreichungsform von OLPs lässt sich für einzelne Einsatzgebiete optimieren
Die Antworten hingen in großem Maße von den Vorerfahrungen der Teilnehmenden und vom angenommenen Einsatzgebiet der Placebos ab. Die Forscherinnen raten daher, bei Versuchen mit OLPs die Darreichungsform der Tabletten für die zu behandelnde Erkrankung zu optimieren. So könne es sinnvoll sein, dass OLPs für Erkrankungen, für die es bereits prominente Arzneimittel gibt (z. B. gegen Schmerzen oder Schlafstörungen), den vorhandenen Medikamenten ähneln. Wenn Symptome hingegen weniger stark mit einer bestimmten Art von Medikamenten assoziiert sind (z. B. zur Verbesserung der Kognition oder bei Müdigkeit), könnten andere Faktoren wie die Attraktivität für Patienten berücksichtigt werden.
Zu beachten ist den Autorinnen zufolge allerdings, dass die spezifischen Präferenzen und Erwartungen von Patientinnen und Patienten wahrscheinlich von Land zu Land unterschiedlich sind und von den üblichen Pillenformen, früheren Erwartungen und dem Wissen über die Behandlung beeinflusst werden.