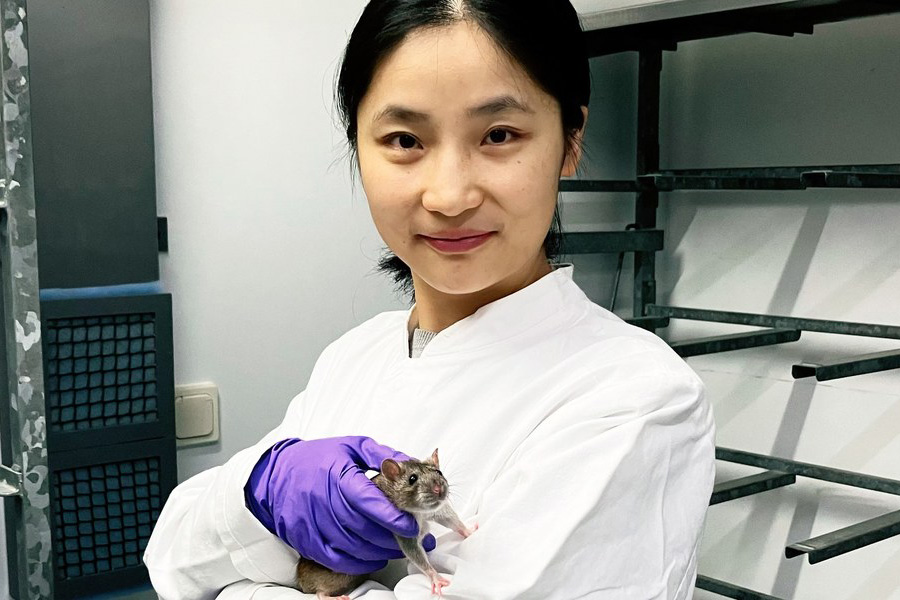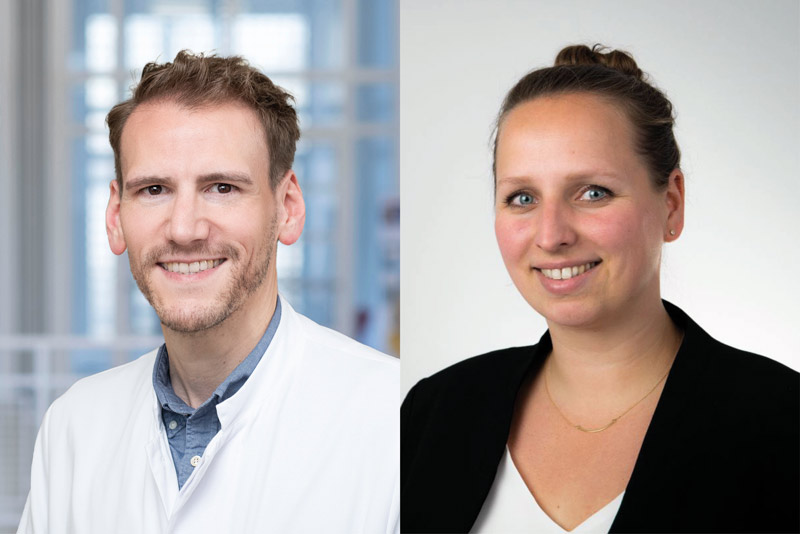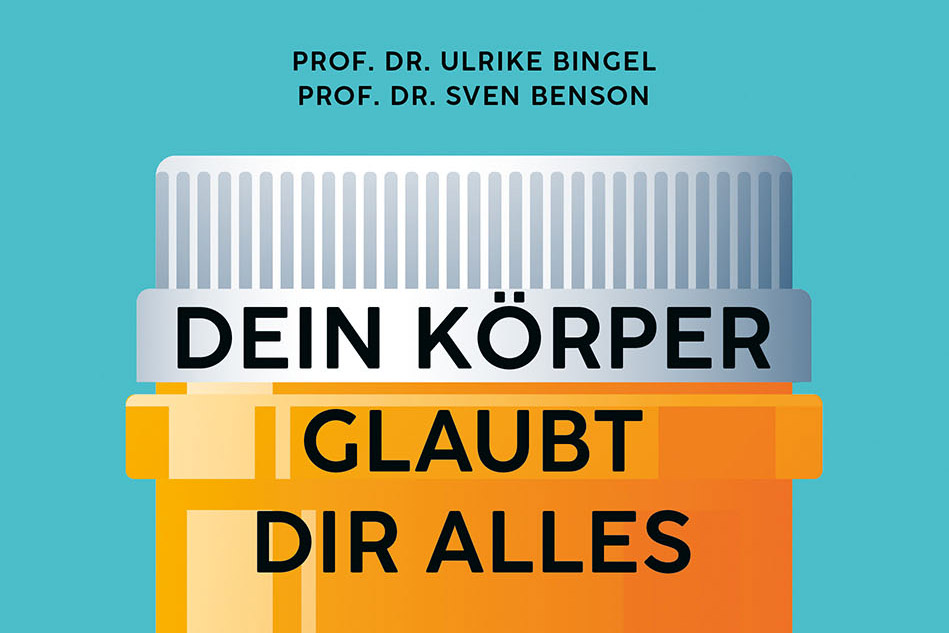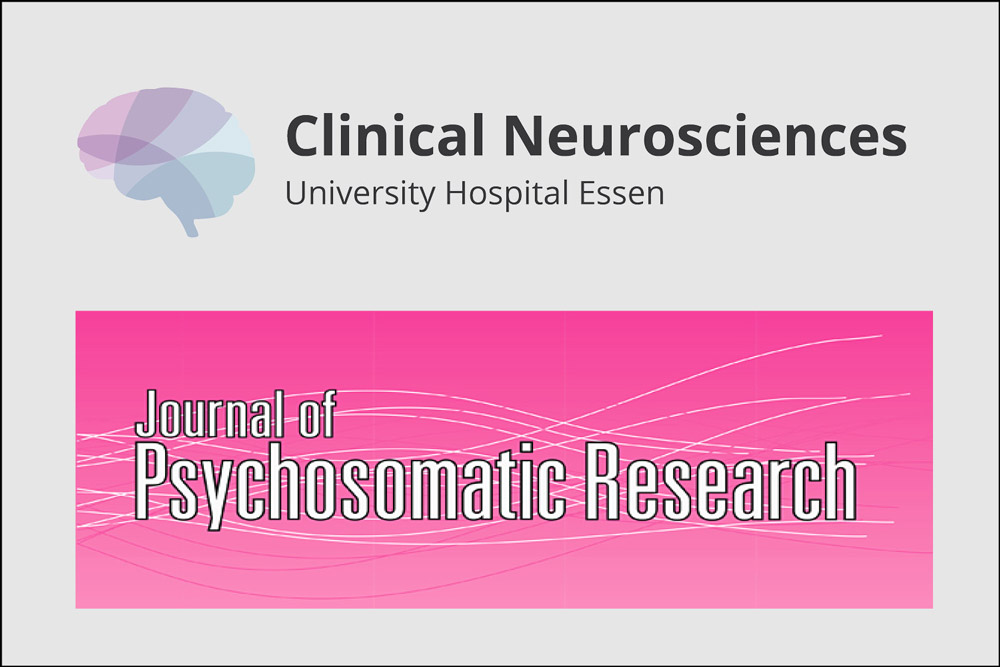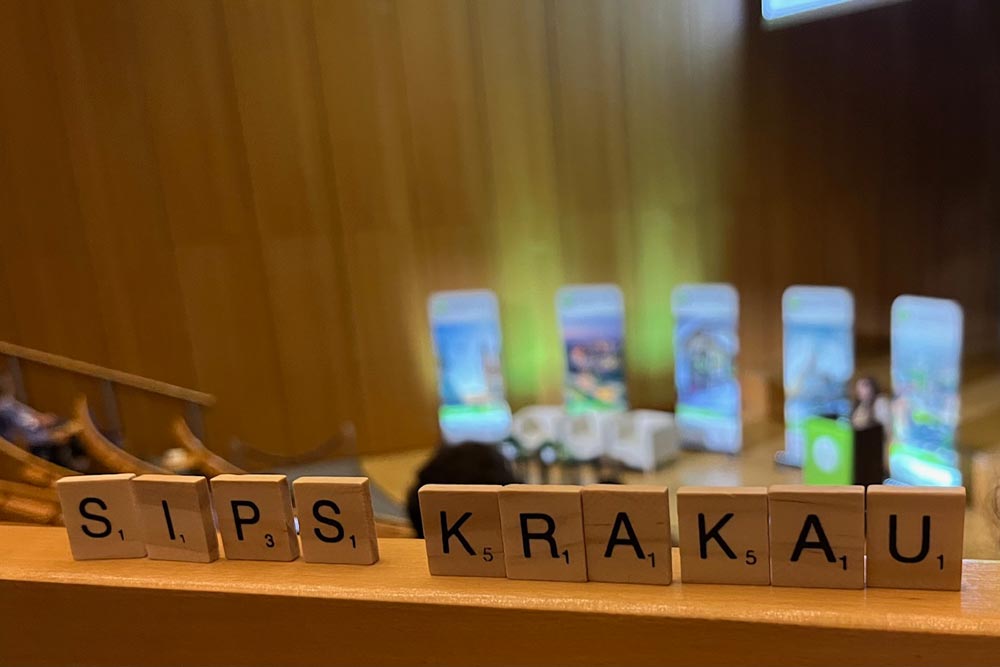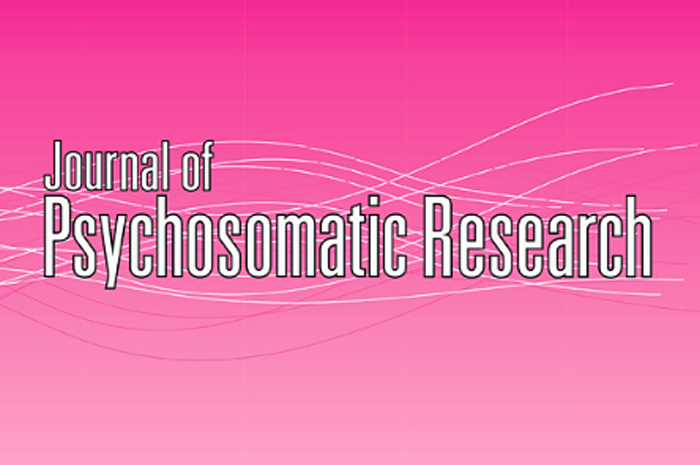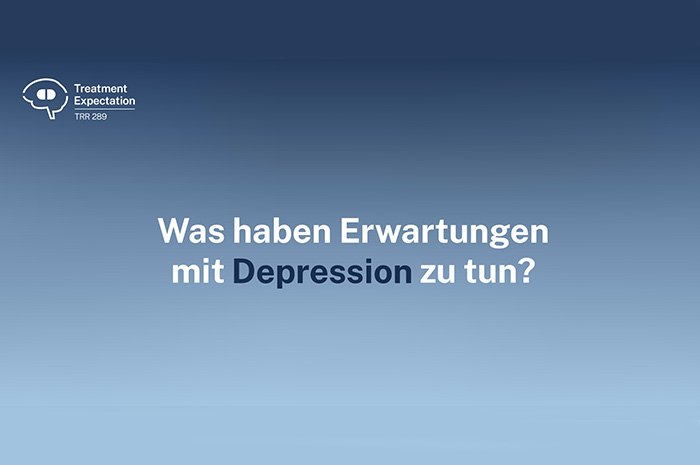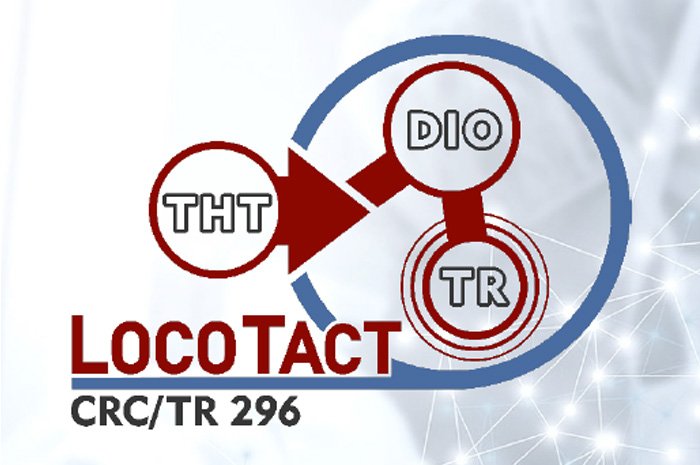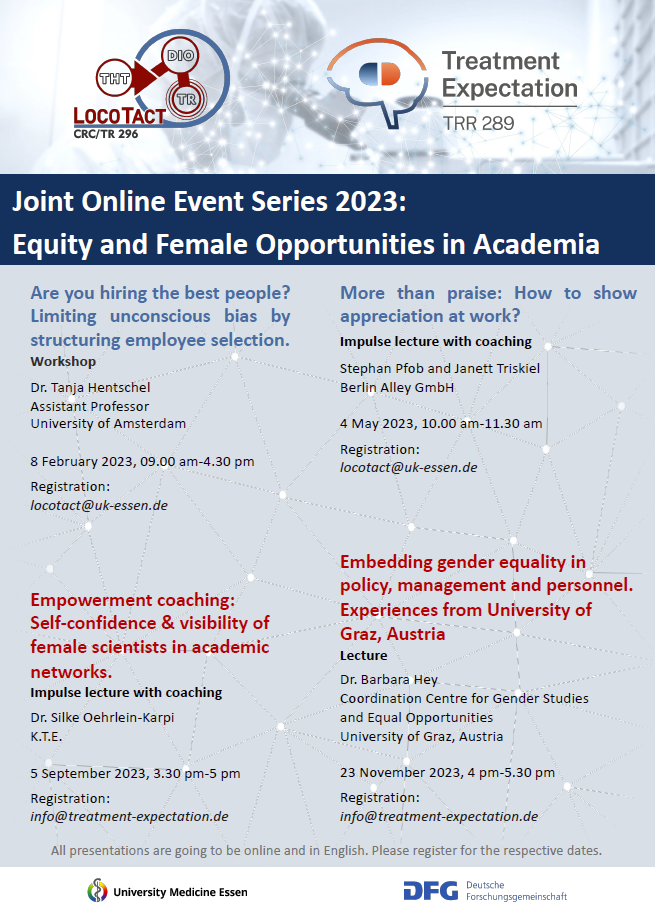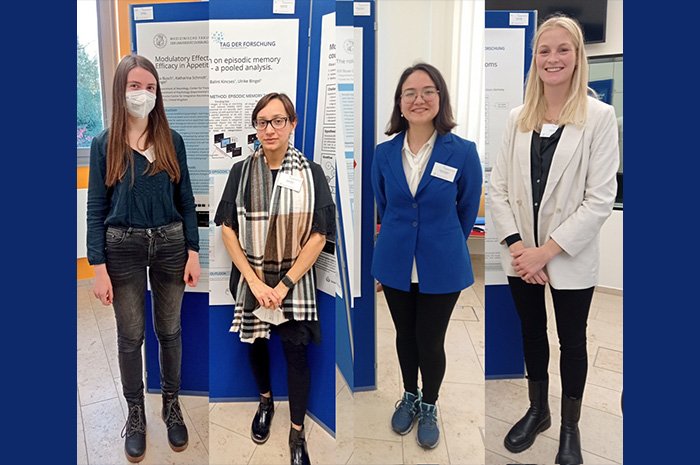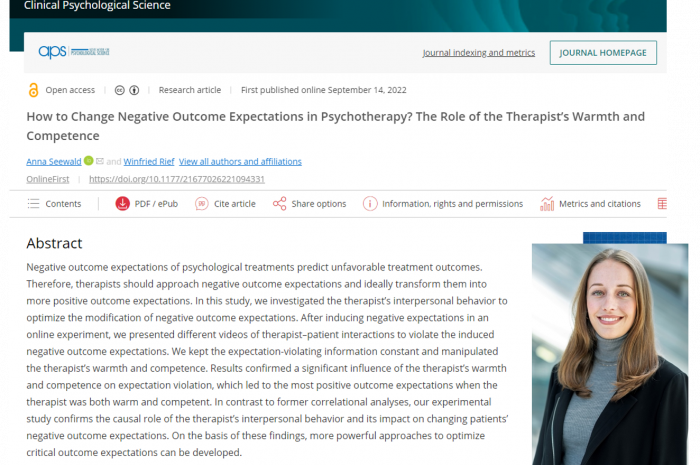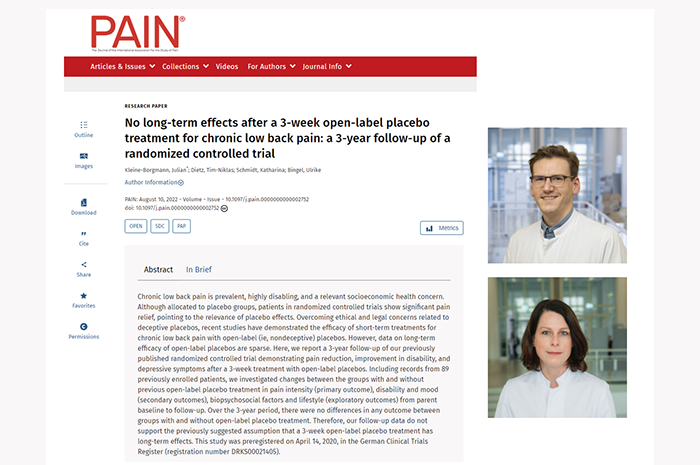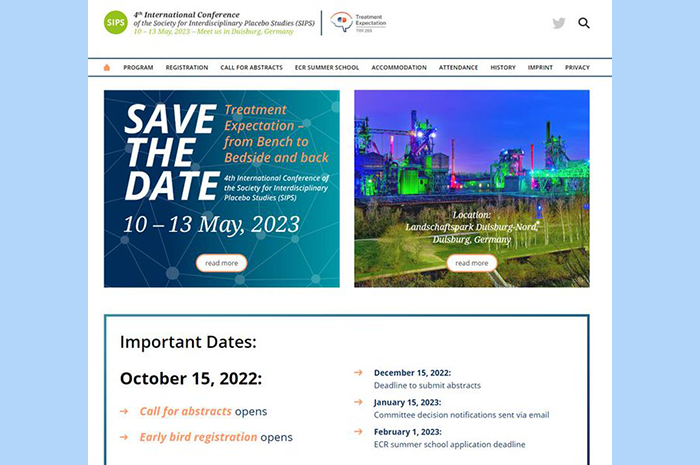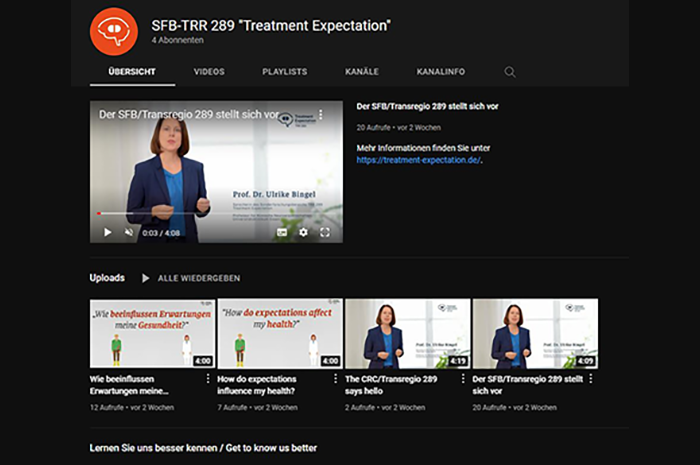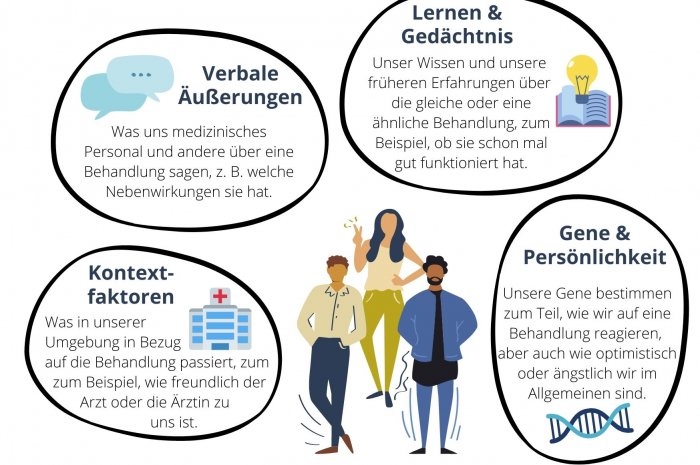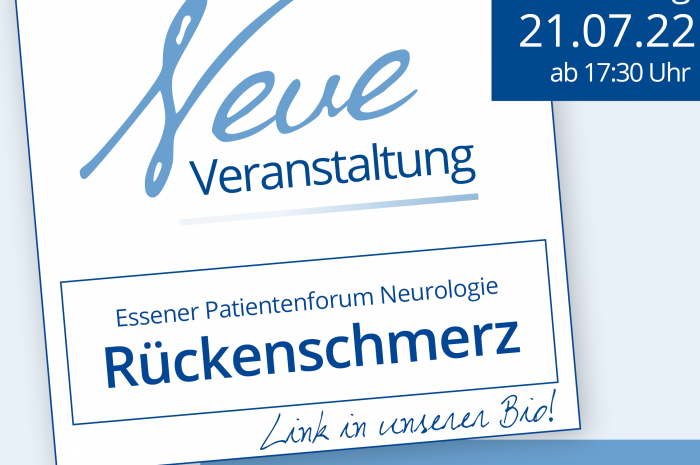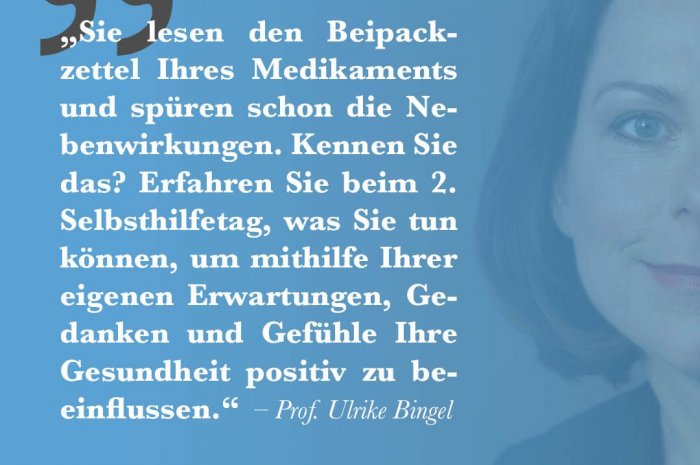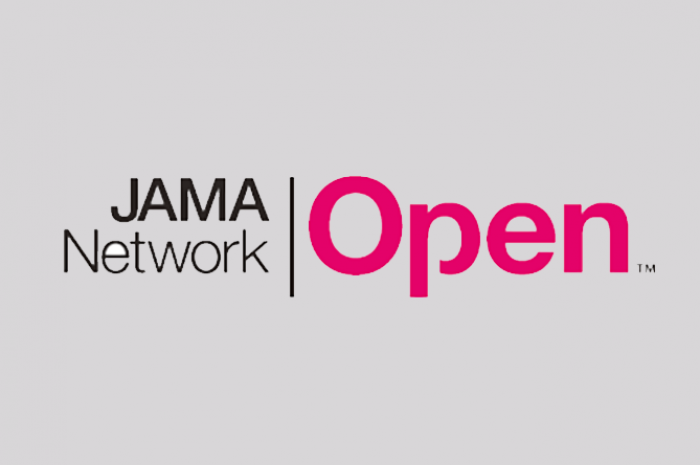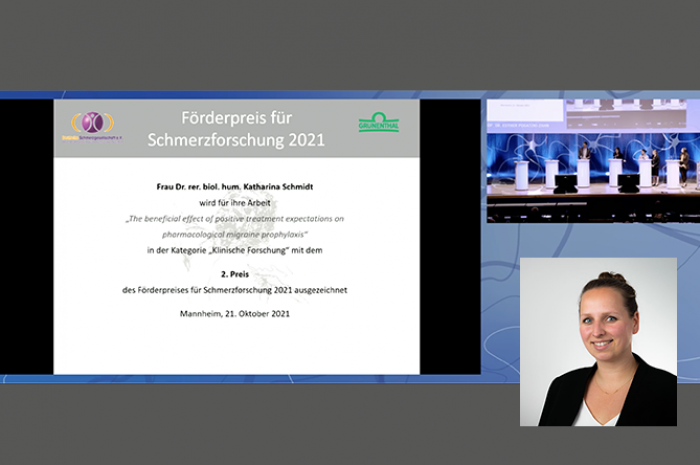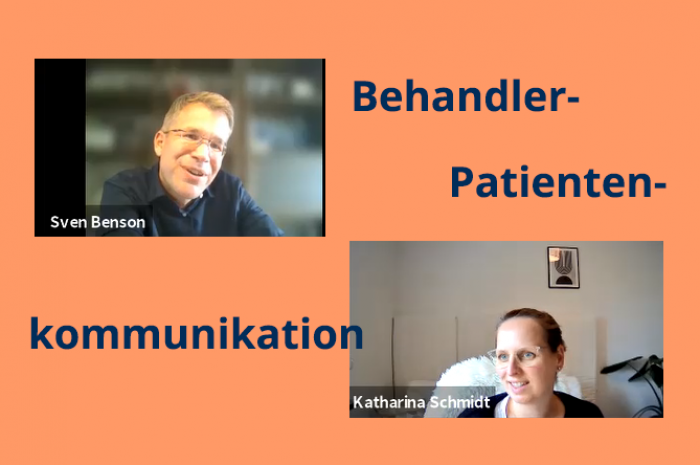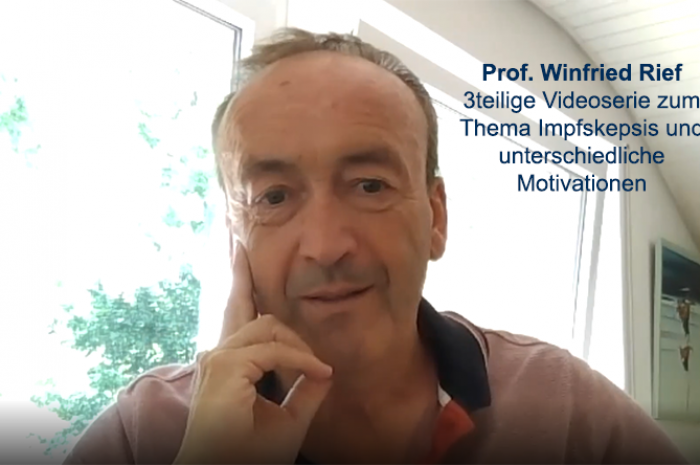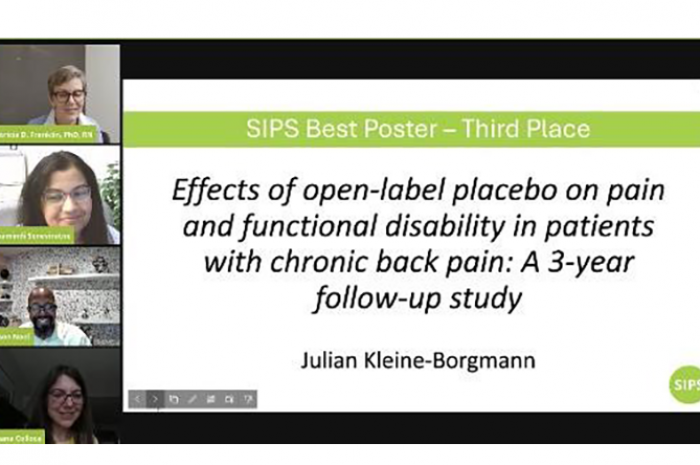Placebos können heilen helfen, das ist seit langem bekannt. Doch dürfen sie überhaupt im Rahmen einer regulären Therapie eingesetzt werden? Rechtswissenschaftlerin Dr. Annabelle Wolf zählt auf, was Behandelnde darüber wissen sollten – und erklärt, wie eine „antizipierte Rahmeneinwilligung“ das Aufklärungsdilemma bei Placebo-Therapien lösen kann.
Bislang werden Placebos vor allem in klinischen Studien eingesetzt. Seit vielen Jahren wird jedoch immer deutlicher, dass sie auch Therapien wirksam unterstützen oder gar in gewissem Umfang ersetzen können. Allerdings wirft der Einsatz von Placebos außerhalb klinischer Studien einige zusätzliche juristische Fragen auf. Wie eine Therapie ohne nachgewiesenen therapeutischen Wirkstoff rechtlich sicher und ethisch verantwortlich ablaufen kann, hat die Rechtswissenschaftlerin Dr. Annabelle Wolf im Rahmen ihrer Doktorarbeit an der Universität Münster untersucht.
Die Veröffentlichung ihrer Dissertation mit dem Titel „Placebos und Behandlungsvertrag – Rechtliche Rahmenbedingungen für den therapeutischen Einsatz von Placebos“ wurde gefördert durch den Sonderforschungsbereich „Treatment Expectation“ (SFB/TRR 289). Die Zusammenfassung der Arbeit kann hier heruntergeladen werden. Die komplette, 400-seitige Dissertation steht auf mohrsiebeck.com zum Download bereit.
(Einen kürzeren Artikel zu diesem Thema speziell für Patienten und Patientinnen finden Sie hier.)

Dr. Annabelle Wolf über die wichtigsten rechtlichen Aspekte beim Einsatz von Placebos in der Therapie
Frau Wolf, gilt immer: Wer heilt, hat Recht?
Der Grundsatz „Wer heilt, hat Recht" gilt nicht als allgemeine Regel, wenn dabei das Selbstbestimmungsrecht des Patienten außer Acht gelassen wird. Das Selbstbestimmungsrecht wiegt schwerer als potenzielle Behandlungserfolge, die auf der Täuschung des Patienten beruhen, auch wenn die Täuschung zum vermeintlichen Wohl des Patienten erfolgt.
Welche zwei Prinzipien sind dabei von Bedeutung?
Die folgenden beiden Prinzipien sind im Kontext des Behandlungsvertragsrechts von grundlegender Bedeutung und haben eine verfassungsrechtliche Verankerung:
a) Selbstbestimmungsrecht des Patienten und der Patientin (Patientenautonomie): Dieses Prinzip ist verfassungsrechtlich in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verankert. Es gilt als Schlüsselbegriff des modernen Medizinrechts. Die Patientenautonomie verleiht dem Patienten das Recht, selbst zu entscheiden, ob, von wem und in welchem Umfang konkrete Behandlungsmaßnahmen an ihm vorgenommen werden. Das Selbstbestimmungsrecht ist einfachgesetzlich insbesondere in den behandlungsvertraglichen Regelungen in §§ 630a-h BGB sowie in den kammersatzungsrechtlichen Regelungen der MBO-Ä konkretisiert.
b) Ärztliche Therapiefreiheit: Die Therapiefreiheit des Arztes und der Ärztin ist ebenfalls ein Grundprinzip des Behandlungsvertragsrechts. Sie ist verfassungsrechtlich in Art. 12 GG verankert und wirkt sich insbesondere in der Regelung des § 630a Abs. 2 BGB aus. Sie wird häufig als „Kernstück des ärztlichen Berufes" bezeichnet. Hinter ihr stecken drei Grundelemente. Zum einen ist dem Arzt die Entscheidung zu gewähren, ob er eine Behandlung vornehmen möchte. Zum anderen darf er nicht zur Durchführung einer seinem Gewissen oder Standesethos widersprechenden Methode gezwungen werden. Zuletzt ist der Arzt frei in der Wahl der geeignet erscheinenden Diagnostik- und Therapiemethode.
Das Verhältnis zwischen ärztlicher Therapiefreiheit und dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten stellt ein Spannungsverhältnis zwischen Paternalismus und Partnerschaftlichkeit dar, besonders wenn Wohl und Wille des Patienten nicht übereinstimmen. Die Grenzziehung zwischen diesen Prinzipien erfolgt primär über die Statuierung von Sorgfalts- und Aufklärungspflichten.
Was bedeutet die Sorgfalts- und Informationspflicht der Behandelnden in Bezug auf Placebo-Behandlungen?
Insgesamt sind in diesem Zusammenhang vier Punkte zu beachten:
- Sorgfaltsgemäße Wahl einer Placebo-Behandlung:
Die Behandlung hat nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen (§ 630a Abs. 2 BGB). Die Wahl der Placebo-Therapie ist angesichts der aktuellen Forschungsergebnisse nicht prinzipiell sorgfaltswidrig. Placebo-Behandlungen können im Einzelfall den medizinischen Standards genügen. Insbesondere deuten die S3-Leitlinien-Empfehlung zur „Behandlung akuter perioperativer und posttraumatischer Schmerzen“ und die vielzähligen klinischen Studien im Bereich analgetischer Placebo-Effekte darauf hin, dass Placebos potenziell geeignet sind, in diesem Bereich den medizinischen Standards zu entsprechen.
Selbst wenn Placebo-Behandlungen nicht den medizinischen Standards zugeordnet werden können, kann sich der Einsatz von Placebos dennoch im rechtlichen Rahmen der fachlichen Standards gemäß § 630a Abs. 2 BGB bewegen. Das Recht kann im Einzelfall einen besonderen, erhöhten Maßstab für die zu berücksichtigenden Sorgfaltspflichten bei Placebo-Behandlungen vorschreiben. Dies gilt insbesondere bei Erkenntnisunsicherheiten bezüglich der Erfolgsaussichten, Belastungen und Risiken. Die Schwere der Erkrankung und des Eingriffs können zudem Einfluss auf den Sorgfaltsmaßstab haben.
Der Arzt muss die Eignung der konkreten Placebo-Methode feststellen und aus objektiver Sicht von einem potenziellen Therapieerfolg ausgehen. Es muss im Rahmen einer Nutzen-Risiko-Abwägung hinsichtlich der konkreten Placebo-Behandlung geprüft werden, ob die zu vermutenden Risiken und Nebenwirkungen die zu erwartenden Erfolgsaussichten und Vorteile nicht überwiegen. Zudem ist eine Nutzen-Risiko-Abwägung in Bezug auf Behandlungsalternativen durchzuführen.
- Sorgfaltspflicht bei der Durchführung einer Placebo-Behandlung:
Während des gesamten Behandlungsverlaufs bestehen die ärztlichen Pflichten zur ständigen Kontrolle und zur erneuten Abwägung insbesondere dann, wenn eine alternative Verum-Behandlung zur Verfügung steht. Erhöhte Sorgfaltspflichten gelten bei einer Placebo-Behandlung, wenn sich während des Behandlungsverlaufs Risiken bei dem Patienten abzeichnen oder sich neue medizinische Erkenntnisse ergeben.
- Behandlungsbezogene Informationspflichten (§ 630c Abs. 2 BGB):
Die behandlungsbezogenen Informationspflichten dienen der Wahrung des Selbstbestimmungsrechts und dem dem Behandlungsvertrag zugrunde liegenden Partnerschaftsgedanken. Bei verdeckten Placebo-Behandlungen greift kein Entbehrlichkeitsgrund für diese Informationspflichten (§ 630c Abs. 4 BGB). Der Arzt muss den Patienten in besonderem Maße über die Notwendigkeit von Folge- und Kontrolluntersuchungen informieren, um frühzeitig festzustellen, ob der Patient auf das Placebo anspricht.
- Wirtschaftliche Informationspflichten (§ 630c Abs. 3 BGB):
Da die (sozial-)rechtliche Frage nach der Kostenübernahme von Placebo-Behandlungen bislang ungeklärt ist, ist der Behandelnde zur wirtschaftlichen Information verpflichtet. Er muss den Patienten über die Ungewissheit der Kostenerstattung durch Dritte (gesetzliche oder private Krankenversicherung) und über die Höhe der potenziellen Kosten informieren. Es bedarf zudem des Hinweises, dass der Patient bei dem Versicherer die Kostenerstattung erfragen soll.
Was ist Ihre Definition von einem Medizinischen Standard?
Der Begriff des „medizinischen Standards“ bezeichnet die medizinische Auslegung der „fachlichen Standards“ im Sinne des § 630a Abs. 2 BGB. Der medizinische Standard hängt maßgeblich von den drei Komponenten der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, der ärztlichen Erfahrung sowie der professionellen Akzeptanz ab. Zur Feststellung des medizinischen Standards werden insbesondere, aber nicht ausschließlich, Leitlinien von internationalen und nationalen Ärzteorganisationen und medizinischen wissenschaftlichen Fachgesellschaften herangezogen, ohne dass diesen Leitlinien automatisch normativer Charakter zukommt.
Sind Placebo-Behandlungen ein Heilversuch?
Unter den Begriff des Heilversuchs werden von der juristischen Fachliteratur regelmäßig innovative, in der Erprobung befindliche Behandlungsmethoden subsumiert, die sich in der Zukunft als Standardmethode etablieren sollen. Der Begriff taucht weder in den behandlungsvertraglichen Regelungen der §§ 630a–h BGB noch in der Gesetzesbegründung auf. Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Verankerung des Heilversuchs und dessen Nichtnennung in der Gesetzesbegründung ist die Gabe von Placebos nicht als Heilversuch einzuordnen. Die rechtliche Einordnung der konkreten Placebo-Behandlung hat an den (oben dargestellten) Vorgaben des § 630a Abs. 2 BGB zu erfolgen.
Trotzdem sind Placebo-Behandlungen grundsätzlich zulässig, richtig?
Das ist korrekt. Der Einsatz von Placebos ist angesichts der aktuellen Forschungsergebnisse und der objektivierbaren und messbaren Wirkungen nicht per se als unzulässig einzustufen. Placebo-Behandlungen können im Einzelfall den medizinischen Standards entsprechen.
Warum sind Placebo-Behandlungen dann trotzdem problematisch?
Der Hauptkonflikt liegt im „Aufklärungsdilemma“ der Placebo-Behandlung.
- Potenzielle Zerstörung des Heilerfolgs: Klärt der Arzt den Patienten über die Placebo-Gabe auf, zerstört er möglicherweise den Placebo-Effekt und damit den potenziellen Heilerfolg.
- Verletzung des Selbstbestimmungsrechts: Unterlässt der Arzt die Aufklärung und verschweigt die Placebo-Gabe, verletzt er das Selbstbestimmungsrecht des Patienten und setzt sich unabsehbaren haftungsrechtlichen Risiken aus.
Die verdeckte Placebo-Behandlung macht dabei das Spannungsverhältnis zwischen Paternalismus und Partnerschaftlichkeit besonders deutlich.
Torpediert die Informationspflicht also den Placebo–Effekt?
Die klassische Annahme ist, dass die wahrheitsgemäße Aufklärung den Placebo-Effekt torpediert und damit den Heilerfolg vereiteln könnte. Dieses Problem wird als das Kernstück des Aufklärungsdilemmas betrachtet.
Allerdings belegen aktuelle medizinische Studien, dass die explizite Information des Arztes über die Placebo-Eigenschaft (sogenannte offene Placebo-Gaben) nach neuen Erkenntnissen der Herbeiführung eines Placebo-Effekts und damit eines Heilerfolgs nicht entgegensteht. Die Erkenntnisse aus den Studien zur offenen Placebo-Gabe geben Hinweise darauf, dass eine aktive Nutzung des Placebo-Effekts auch dann erfolgen kann, wenn der Arzt umfangreich über die pharmakologische Wirkungslosigkeit und die Möglichkeit der Nutzbarmachung des Placebo-Effekts in verständlicher Weise aufklärt.
Hinsichtlich der konkreten Aufklärung des Arztes über die Gabe des Placebos benennen Forscher zum Teil vier Bedingungen, die erfolgversprechend bei einer offenen Placebo-Behandlung zu beachten sind:
- Aufklärung in Bezug auf die bisherigen Erkenntnisse über den Placebo-Effekt,
- Unterstützung bei der Ausräumung diesbezüglicher Zweifel,
- Hinweise, die zu einer positiven (und trotzdem realistischen) Erwartungshaltung beitragen,
- Anweisungen zur Einhaltung eines festen Rituals bei der Einnahme des Placebos.
Was bedeutet eine Nutzen-Risiko-Abwägung bei Placebo-Behandlungen?
Die Nutzen-Risiko-Abwägung ist eine zentrale Sorgfaltspflicht des Arztes. Zuvor bedarf es der sorgfältigen Prüfung, ob die Placebo-Methode geeignet ist, das gewünschte Behandlungsziel zu erreichen.
Danach ist eine zweifache Nutzen-Risiko-Abwägung durchzuführen. Im Rahmen der konkreten Abwägung der einzelnen Placebo-Behandlung dürfen die zu vermutenden Risiken und Nebenwirkungen die zu erwartenden Erfolgsaussichten und Vorteile nicht überwiegen. Grundsätzlich ist bei der Verabreichung von Placebos angesichts ihrer Wirkstofflosigkeit nicht von einer Gefahr gravierender Gesundheitsrisiken für den Patienten auszugehen. Insbesondere besteht bei der Placebo-Behandlung in der Regel keine Gefahr einer Resistenzbildung. Wenn keine andere (Verum-)Behandlung in Betracht kommt, entscheidet der Arzt nach vorheriger Nutzen-Risiko-Abwägung über die Wahl der Placebo-Behandlung.
Sofern Behandlungsalternativen zur Placebo-Methode bestehen, bedarf es in einem weiteren Schritt der relativen Nutzen-Risiko-Abwägung, um so der Gefahr des Eintritts solcher Schäden zu begegnen, die durch das Vorenthalten einer gebotenen Verum-Therapie entstehen können.
Für den Arzt oder die Ärztin ist entscheidend, dass die Placebo-Methode:
- im Vergleich zu anderen Behandlungsvarianten die wenigsten Nebenwirkungen aufweist,
- und den größten oder zumindest gleichwertigen Erfolg verspricht.
Generell sind Placebos oft risikoärmer als pharmakologisch wirksame Verum-Mittel, da sie aufgrund ihrer Wirkstofflosigkeit keine Gefahr schwerwiegender Nebenwirkungen bergen.
Grundsätzlich ist die Wahl der Placebo-Gabe sorgfaltswidrig, wenn die Placebo-Behandlung im Vergleich zu einer Verum-Behandlung geringere Heilungschancen erwarten lässt. Wählt der Arzt in diesem Falle dennoch eine Placebo-Behandlung, bedarf es einer medizinisch-sachlichen Rechtfertigung etwa durch besondere Sachzwänge des konkreten Einzelfalls. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn bei einem Fehlschlag der Placebo-Behandlung eine Verum-Therapie noch möglich erscheint, ohne dass die Gefahr einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands besteht.
Welche Bedeutung hat das therapeutische Privileg in diesem Zusammenhang?
Das therapeutische Privileg ist ein in der juristischen Diskussion angeführter, aber ungeschriebener Entbehrlichkeitsgrund der Aufklärungspflicht im Sinne des § 630e Abs. 3 BGB. Es bezeichnet die paternalistische Vorenthaltung von Informationen, (vermeintlich) zum Wohl des Patienten.
Nach der Formel des Bundesgerichtshofs kann aus therapeutischen Gründen von der Aufklärung abgesehen werden, soweit die Aufklärung das Leben oder die Gesundheit des Patienten ernstlich gefährdet. Die jüngste Rechtsprechung lehnt ein therapeutisches Privileg ausdrücklich ab, da es die Gefahr birgt, das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu untergraben. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten wiege schwerer als potenzielle Behandlungserfolge, die auf der Ausnutzung eines grundlegenden Informationsgefälles zwischen Behandelnden und Patienten basierten. Therapeutische Gründe können allenfalls die Art und Weise der Aufklärung (schonend, rücksichtsvoll, einfühlsam) beeinflussen, nicht aber deren Umfang einschränken oder zum vollständigen Entfallen der Aufklärung führen.
Wie sehen Sie das Spannungsfeld zwischen Aufklärungspflicht und Aufklärungsverzicht?
Das Recht auf Aufklärung und das Recht auf Nichtwissen sind unterschiedliche Ausprägungen des Selbstbestimmungsrechts des Patienten. Die personale Autonomie umfasst das Recht, selbst zu entscheiden, ob man mit Informationen und Verantwortung belastet werden möchte.
Der Aufklärungsverzicht muss gemäß § 630e Abs. 3 Hs. 2 Var. 2 BGB ausdrücklich erfolgen. Um dem Selbstbestimmungsrecht konsequent Rechnung zu tragen, ist auch ein „Blankoverzicht“ (universeller Verzicht auf ärztliche Aufklärung) möglich, ohne dass eine vorherige „Basisaufklärung“ zwingend erforderlich ist.
Allerdings sind an den Verzicht strenge Anforderungen zu stellen, um eine Aushöhlung der Aufklärungspflicht zu vermeiden und das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu wahren. Der Verzicht muss klar und eindeutig, bewusst und gewollt erklärt werden. Das Wort Verzicht muss allerdings nicht zwingend fallen. Der Arzt darf den Patienten nicht zum Verzicht drängen oder manipulativ beeinflussen. Ein zulässiger ärztlicher Impuls für einen Verzicht ist anzunehmen, wenn der Behandelnde in einem behutsamen, verständnisvollen Gespräch sowohl auf das Recht des Patienten zur Aufklärung als auch darauf hinweist, dass eine Aufklärung erfolgt, sofern der Patient nicht auf diese verzichtet. Wichtig ist zudem das Recht des Patienten auf jederzeitigen Widerruf der Verzichtserklärung (ex nunc) ohne zwingende Nennung von Gründen.
Warum ist für Sie die antizipierte Rahmeneinwilligung nach Aufklärung die juristische wie ethische Lösung des Dilemmas?
Die antizipierte Rahmeneinwilligung nach Aufklärung ermöglicht, das Aufklärungsdilemma bei Placebo-Behandlungen interessengerecht zu lösen, indem Placebos unter Wahrung des Patientenwohls und -willens in behandlungsvertraglich zulässiger Weise genutzt werden können. Der Patient wird frühzeitig aufgeklärt, dass später wahlweise ein Placebo oder ein Verum zum Einsatz kommen kann und er im Moment der Verabreichung nicht genau weiß, um welches Mittel es sich handelt. Dieses Konstrukt gewährleistet eine praktikable, juristisch und ethisch fundierte Handhabung. Fünf Gründe sind anzuführen:
- Wahrung der Autonomie: Der Patient wird frühzeitig wahrheitsgetreu und vollständig aufgeklärt über die Placebo-Möglichkeit, deren Wirkmechanismen und die Grenzen ärztlicher Entscheidungsfreiheit. Es besteht zudem die Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs der Einwilligung, des expliziten Nachfragens des Patienten und der Vereinbarung eines konkreten Zeitraums für die Wirksamkeit der Einwilligung.
- Entpaternalisierung: Die Konstruktion nimmt der später erfolgenden, verdeckten Placebo-Behandlung jeden paternalistischen, das Selbstbestimmungsrecht des Patienten verkürzenden Charakter. Der Patient trifft selbstbestimmt die Entscheidung, dem Arzt einen Entscheidungsspielraum zu gewähren.
- Keine Zerstörung des Effekts: Der Arzt erhält die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt – ohne erneute Aufklärung kurz vor der Anwendung – über die Gabe eines Placebos oder Verums zu entscheiden. Dadurch wird die Suggestion einer pharmakologisch wirksamen Therapie, die für den Placebo-Effekt relevant ist, nicht vereitelt.
- Gewährleistung der Sorgfalt: Der Rahmen der Einwilligung wird durch die Beachtung der Sorgfaltsanforderungen aus § 630a Abs. 2 BGB abgesichert. Der Patient ist darüber aufzuklären, dass der Arzt erst nach Erteilung der Rahmeneinwilligung die Eignung der Methode prüfen, eine Nutzen-Risiko-Abwägung in Bezug auf die potenzielle Placebo-Behandlung sowie eine Abwägung im Vergleich zu den möglichen Behandlungsalternativen vornehmen wird. Es ist über den Ablauf und die Kriterien der späteren ärztlichen Nutzen-Risiko-Abwägung zu informieren, welche die Grundlage der ärztlichen Entscheidung bilden.
- Vertrauensförderung: Die vollständige und umfassende Aufklärung wirkt vertrauensstiftend und -fördernd und kann durch die entstehende positive Erwartungshaltung des Patienten zu besseren Heilerfolgen führen.
Inwieweit werden haftungsrechtliche Fragen berührt?
Haftungsrechtliche Besonderheiten des Placebo-Einsatzes ergeben sich angesichts des Aufklärungsdilemmas insbesondere bei der Aufklärungsfehlerhaftung.
- Aufklärungsfehler: Eine fehlende oder fehlerhafte Aufklärung über die Placebo-Gabe stellt eine Verletzung des verfassungsrechtlich garantierten Selbstbestimmungsrechts dar.
- Isolierte Aufklärungsfehlerhaftung: Gerade bei Placebo-Behandlungen, die oft als „harmlos" gelten und in der Regel keine Körper- oder Gesundheitsschäden verursachen, stellt sich die Frage der Haftung bei isoliertem Aufklärungsfehler.
- Ersatzfähigkeit immaterieller Schäden: Die Verletzung des verfassungsrechtlich verankerten Selbstbestimmungsrechts ist über eine freiheitsrechtliche Auslegung des Merkmals „Körper“ gemäß § 253 Abs. 2 BGB als immaterieller Schaden ersatzfähig, selbst wenn kein zusätzlicher Gesundheitsschaden eintritt.
- Ersatzfähigkeit materieller Schäden: Sofern der Arzt einen Aufklärungsfehler begangen hat und die grundsätzlich erfolgreiche Behandlung mit Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen – beispielsweise mit Nocebo-Effekten – verbunden ist, können diese als Körper- und Gesundheitsschäden nach §§ 249 ff. BGB erstattungsfähig sein. War die Placebo-Behandlung nicht erfolgreich und die vorherige Aufklärung nicht ordnungsgemäß, kann der Patient die Schäden infolge unveränderten Zustands, der Verschlimmerung von Symptomen oder des Auftretens zusätzlicher Krankheitssymptome nach §§ 249 ff. BGB geltend machen.
- Weitere Pflichtverletzung neben Aufklärungsfehler: Sofern der Arzt seiner Sorgfaltspflicht bei Durchführung der Placebo-Behandlung nicht nachkommt, indem er nicht rechtzeitig den Abbruch der Placebo-Behandlung und die Substitution des Placebos durch ein Verum in Betracht zieht und darüber aufklärt, liegt darin eine weitere zum Schadensersatz berechtigende Pflichtverletzung.
- Hypothetische Einwilligung: Bei einem Aufklärungsfehler kann der Arzt versuchen, den Haftungsausschluss wegen rechtmäßigen Alternativverhaltens (§ 630h Abs. 2 Satz 2 BGB) über den Einwand der hypothetischen Einwilligung zu beweisen. Allerdings sind an diesen Beweis strenge Anforderungen zu stellen und der Patient kann den Beweis aushebeln, wenn plausible und nachvollziehbare Gründe darlegt werden, dass man sich in einem ernsthaften Entscheidungskonflikt über die Vornahme der Maßnahme befunden hätte.
- Verletzung der wirtschaftlichen Informationspflicht: Bei Verletzung der wirtschaftlichen Informationspflicht haftet der Arzt auf Schadensersatz in Höhe der vom Dritten (Krankenversicherung) nicht übernommenen Behandlungskosten.
Ärztinnen und Ärzte, die den Einsatz von Placebos zur Behandlung ihrer Patienten in Betracht ziehen, ist zu raten, von einer bewussten Täuschung über die Placebo-Methode abzusehen, um mittels einer ordnungsgemäßen Aufklärung eine Verletzung des verfassungsrechtlich verankerten Selbstbestimmungsrechts des Patienten und damit einhergehende haftungsrechtliche Folgen zu vermeiden.
Sind nicht offene Placebogaben die juristisch sauberste Lösung?
Offene Placebo-Gaben, bei denen der Arzt den Patienten vor der Einnahme über die Placebo-Eigenschaft informiert und ihm die Möglichkeit gibt, bewusst einzuwilligen, stellen die juristisch sauberste Lösung dar.
Aktuelle Erkenntnisse aus medizinischen Studien zur offenen Placebo-Gabe geben Hinweise darauf, dass eine aktive Nutzung des Placebo-Effekts auch dann erfolgen kann, wenn der Arzt umfangreich über die pharmakologische Wirkungslosigkeit und die Möglichkeit der Nutzbarmachung des Placebo-Effekts in verständlicher Weise aufklärt. Sofern weitere klinische Studien die positiven Erkenntnisse der offenen Placebo-Gabe gesichert bestätigen, könnte diese je nach Indikation als Monotherapie eine ethisch und rechtlich vertretbare Lösung für das Aufklärungsdilemma darstellen.
Muss eine Patientin oder ein Patient auch dann informiert werden, wenn sie oder er gleichzeitig ein Medikament und ein Placebo bekommt, etwa zur Konditionierung?
Die Strategie, Konditionierungseffekte auszunutzen, indem intermittierend Verum- und Placebo-Gaben kombiniert werden, kann zur Reduktion der Verum-Dosis und damit zur Vermeidung von Nebenwirkungen insbesondere von Resistenzbildungen führen. Zudem könnte es eine kostengünstigere Lösung im Vergleich zur reinen Verum-Behandlung darstellen.
Dieses Vorgehen ist jedoch nicht zulässig, ohne dass der Patient zuvor aufgeklärt wird.
Der Patient muss im Großen und Ganzen über das Für und Wider sowohl der Verum- als auch der Placebo-Behandlung nach Maßgabe von § 630e Abs. 1 bis 4 BGB aufgeklärt werden. Einwilligungsrelevant ist dabei insbesondere der Umstand, dass der Patient im Unklaren gelassen werden soll, wann intermittierend Verum-Gaben durch Placebos ersetzt werden. Der Patient muss über die Vorteile dieser Konstruktion, etwa die Verhinderung von Nebenwirkungen und Resistenzbildungen durch die Dosisreduktion, informiert werden.
Die Notwendigkeit dieser umfassenden Aufklärung ergibt sich aus dem Gebot der Wahrhaftigkeit und Vollständigkeit, um die Patientenautonomie zu wahren.
„Rechtlicher Rahmen: Was sollten Behandelnde bei einer Anwendung von Placebos beachten?“ – Foto: Dr. Stefan Peters